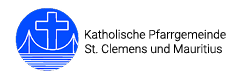In einer Zeit, in der die Kirchenaustritte rasant steigen und die Gesellschaft bei klammen Staatskassen unter einem riesigen Personalmangel leidet, gewinnt das Ehrenamt, das private Engagement, immer mehr an Bedeutung. Was bewegt Menschen dazu, sich mit ihrer Arbeitskraft und großem zeitlichen Aufwand entgeltlos für andere einzusetzen?
Es sind oft humanitäre – Solidarität und ethische Verantwortlichkeit -, bei gläubigen Christen auch religiöse Gründe, wobei die Übergänge fließend sein können. Auf dem Gebiet der sozialen Dienstleistungen hat der Staat weitgehend versagt. Altenbetreuung und -pflege liegen im Argen. Es gibt zu wenig Altenheimplätze, und die vorhandenen sind oft so teuer, dass sich die Familien selbst kümmern müssen. Ein großer Teil der Pflege wird von Angehörigen zu Hause durchgeführt. Zwar bekommen die Pflegenden eine - übrigens lächerlich geringe – Entschädigung, aber der Staat spart Millionen.
Auch auf dem Gebiet der Bildung verlässt sich die Gesellschaft auf Freiwillige, die Kindern bei den Hausaufgaben helfen, mit ihnen lesen, singen und spielen, obwohl die Bildung eine genuin staatliche Aufgabe ist, die in den vergangenen Jahrzehnten sträflich vernachlässigt wurde.
Hinzu kommen Probleme mit Flüchtlingen, ihrer Sprachkompetenz und ihrer Eingliederung in den Arbeitsmarkt.
Die Selbstverständlichkeit, mit der der Staat auf Spenden und freiwillige Helfer zurückgreift, grenzt manchmal schon an Chuzpe. In zunehmendem Maße ist zu konstatieren, dass Helfer, ob ehrenamtlich oder professionell (Polizisten, Sanitäter, Ärzte, Krankenschwestern) seit einigen Jahren Missachtung, ja sogar Gewalt ausgesetzt sind. Das reicht von Behinderungen und Anpöbelungen bis hin zu offener Gewalt. Umso bewundernswerter ist die Standfestigkeit, mit der die Helfer sich nicht von ihrer Arbeit abbringen lassen. Ein gläubiger Christ kann neben Solidaritätsempfinden und ethischer Verantwortlichkeit auch durch das Gebot der Nächstenliebe angetrieben werden. Der klassische Text dazu ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10,25-37). Wer ist mein Nächster? Der Begriff wurde im Laufe der Zeit unterschiedlich diskutiert (Mitmensch, der Andere). Das Gleichnis zeigt, dass sich die Wirkung der christlichen Barmherzigkeit auf alle erstreckt, die der Liebe und Hilfe bedürfen. Der Nächste ist der, der Hilfe braucht und von dem man kein Gegengeschenk erwartet, der nicht innerhalb eigener sozialer Bindungen steht. An den Bedrängten soll man das tun, was wir an uns getan wünschen. Luther fasst es knapp und schlagend zusammen: Der Nächste ist der, der uns braucht; „der Helfer tut, was vor die Hand kommt“. Die situative helfende Tätigkeit zeigt die menschlichen Grenzen, öffnet aber auch neue Horizonte, nämlich eine Perspektive globaler Mitmenschlichkeit. Wir sind uns dessen bewusst, dass ein Einzelner nicht den Hunger in der Welt beheben, den Klimawandel ändern, die Kohlenstoffemissionen reduzieren kann. Aber: Von unserem Standort aus sehen wir noch die Fernsten als Nächste, als Menschen, die unsere Hilfe beanspruchen. Ihre Not rückt uns besonders durch die Massenmedien auf den Leib. Die Verantwortung wird immer größer. Sie ist nicht mehr allein auf einzelne Zuständigkeiten und Handlungen beschränkt, sondern umfasst eine universale präventive Verantwortung für das Sein als Ganzes, die Natur oder die Geschichte. Jeder, der mit Entwicklungshilfe und kirchlichem Weltdienst vertraut ist, weiß, dass die Bereitschaft, fernen Notleidenden zu Hilfe zu kommen, „erweckt“ werden muss.
Im kirchlichen Leben spielt sich das Engagement vorzugsweise an der Basis ab, in den Gemeinden. In Zeiten immer größer werdender Pfarrbezirke sind viele Ehrenamtliche die Bezugsperson vor Ort. Je nach persönlichen Begabungen und Neigungen gestalten sie kirchliches Leben, Gottesdienste und Andachten, machen Kranken- und Hausbesuche und sind Ansprechpartner für Menschen mit Fragen zur Kirche und christlichem Glauben. Sie arbeiten in Gremien mit und in Vereinen. Aber sie verwalten auch die Gebäude, kümmern sich um die Kirchenmusik und unterstützen Gemeindegruppen. Es wird in Zukunft viel davon abhängen, die Professionalität der Haupt- und das Engagement der Ehrenamtlichen gut aufeinander abzustimmen, die Fähigkeiten zur Kooperation zu stärken und die verschiedenen „Charismen“ zur Geltung zu bringen. Von der gemeinsamen Aufgabe her bedarf es eines Bewusstseins, das den Gedanken der Dienstgemeinschaft begründet. Damit die Menschen das Engagement finden, das zu ihren Stärken passt, hat das Erzbistum Köln schon vor Jahren begonnen, Ehrenamtsmanager und -koordinatoren in der „beratergruppe ehrenamt“ auszubilden. Dort wird dafür gesorgt, dass es den Menschen möglich wird, ihre Berufung zu entdecken, sich nach ihren Begabungen zu engagieren sowie eine Anlaufstelle zu haben, in der sie bestärkt, begleitet und weiter qualifiziert werden und so neue Ideen entwickeln können.
Text: Lisa Weyand
Foto: Halfpoint, Quelle: stock.adobe.com